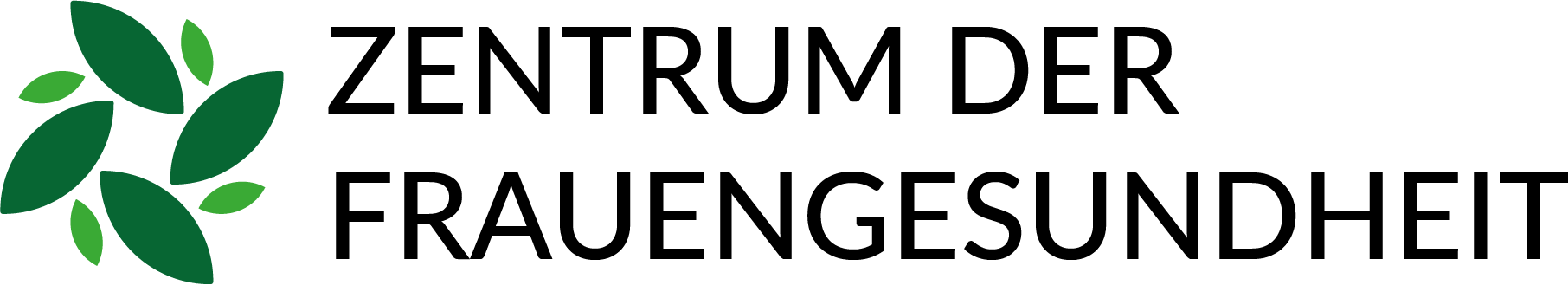Aufbau Scheidenflora: Tipps für eine gesunde Balance und Wohlbefinden
Die Gesundheit der weiblichen Intimregion ist eng mit dem Gleichgewicht der Scheidenflora verbunden. Eine intakte Scheidenflora schützt vor Infektionen und fördert das allgemeine Wohlbefinden. In diesem Artikel beleuchten wir die Bedeutung einer gesunden Scheidenflora, Faktoren, die ihr Gleichgewicht beeinflussen können, und geben praktische Tipps zum Aufbau und Erhalt einer stabilen Vaginalflora.
Aufbau Scheidenflora: Was ist das?
Die Scheidenflora, auch Vaginalflora genannt, bezeichnet die Gesamtheit der Mikroorganismen, die die Scheiden und die Vagina besiedeln. Bei gesunden, geschlechtsreifen Frauen dominieren hierbei Milchsäurebakterien, insbesondere verschiedene Arten von Lactobacillus, die auch als Döderlein-Bakterien bekannt sind. Diese Bakterien fermentieren Glykogen aus den Vaginalepithelzellen zu Milchsäure, wodurch ein saures Milieu mit einem pH-Wert zwischen 3,8 und 4,4 entsteht. Dieses saure Umfeld hemmt das Wachstum pathogener Keime und schützt somit vor Infektionen. Weitere interessante Fakten zur Intimhygiene finden Sie in unseren Blogbeiträgen.
Definition und Funktion der Scheidenflora
Die Scheidenflora, auch als Vaginalflora bekannt, umfasst die Gesamtheit der Mikroorganismen, die die Vagina und Vulva besiedeln. Die Hauptakteure in diesem Mikrokosmos sind die Milchsäurebakterien, insbesondere die Laktobazillen. Diese nützlichen Bakterien sind entscheidend für das saure Milieu der Vagina, das einen pH-Wert zwischen 3,8 und 4,4 aufweist. Ein solcher pH-Wert ist essenziell, um eine gesunde Scheidenflora zu gewährleisten und die Scheide vor schädlichen Keimen zu schützen.
Die Funktionen der Scheidenflora sind vielfältig und von großer Bedeutung für die Frauengesundheit:
Schutz vor Infektionen: Die Milchsäurebakterien produzieren Milchsäure, die das Wachstum pathogener Keime hemmt und somit Infektionen vorbeugt.
Regulierung des pH-Werts: Durch die Produktion von Milchsäure halten die Laktobazillen den pH-Wert der Vagina auf einem gesunden Niveau.
Unterstützung der Immunabwehr: Eine gesunde Scheidenflora stärkt die Immunabwehr der Frau und schützt vor verschiedenen Infektionen.
Aufrechterhaltung einer gesunden Vaginalflora: Die Milchsäurebakterien helfen, das Gleichgewicht der Mikroorganismen in der Vagina zu bewahren und fördern so die allgemeine Gesundheit des Intimbereichs.
Eine intakte und gesunde Scheidenflora ist somit ein wesentlicher Bestandteil der Frauengesundheit und trägt maßgeblich zum Wohlbefinden bei. Die richtige Pflege des Intimbereiches ist entscheidend, um die Gesundheit und das Wohlbefinden zu gewährleisten.
Die Bedeutung eines sauren pH-Werts
Der saure pH-Wert der Vagina spielt eine zentrale Rolle im Schutzmechanismus gegen Krankheitserreger. Milchsäurebakterien senken den pH-Wert und produzieren zusätzlich Wasserstoffperoxid sowie Bakteriozine, die das Wachstum schädlicher Mikroorganismen weiter unterdrücken. Ein stabiles, saures Scheidenmilieu ist somit essenziell für die Abwehr von Infektionen. Hormonelle Schwankungen können die Scheidenflora aus dem Gleichgewicht bringen und das Risiko für Infektionen erhöhen.
Einfluss von Östrogen auf die Scheidenflora
Das Hormon Östrogen spielt eine zentrale Rolle bei der Regulierung der Scheidenflora. Östrogen fördert die Besiedlung der Scheide mit Laktobazillen und hilft, den pH-Wert der Vagina im sauren Bereich zu halten. Während der Menstruationsblutung und kurz danach produziert der Körper weniger Östrogen, was zu einer geringeren Konzentration an Laktobazillen in der Scheide führt. Im Laufe des Zyklus steigt der Östrogenspiegel wieder an, was die Anzahl der Laktobazillen erhöht und somit das saure Milieu der Vagina unterstützt.
Der Einfluss von Östrogen auf die Scheidenflora ist von großer Bedeutung, da er die Balance der Mikroorganismen in der Vagina reguliert. Eine Störung dieser Balance, etwa durch hormonelle Schwankungen, kann das Risiko für Infektionen und andere Probleme im Intimbereich erhöhen. Daher ist es wichtig, den Östrogenspiegel im Körper zu regulieren, um eine gesunde Scheidenflora zu gewährleisten und die Frauengesundheit zu unterstützen.
Durch das Verständnis der Rolle von Östrogen und der Scheidenflora können Frauen besser auf ihre Gesundheit achten und Maßnahmen ergreifen, um das Gleichgewicht ihrer Vaginalflora zu erhalten.
Ursachen für ein Ungleichgewicht der Scheidenflora
Verschiedene Faktoren können das Gleichgewicht der Vaginalflora stören:
Antibiotika-Einnahme: Antibiotika bekämpfen nicht nur schädliche Bakterien, sondern können auch die nützlichen Milchsäurebakterien der Scheidenflora reduzieren.
Hormonelle Schwankungen: Veränderungen im Östrogenspiegel, etwa während der Menopause, Schwangerschaft oder des Menstruationszyklus, beeinflussen die Zusammensetzung der Scheidenflora. Ein niedriger Östrogenspiegel kann zu einer Verringerung der Milchsäurebakterien führen.
Übertriebene Intimhygiene: Häufige Vaginalduschen und die Verwendung ungeeigneter Seifen können die natürliche Flora der Vagina beeinträchtigen und das Risiko für Infektionen erhöhen.
Stress: Chronischer Stress kann das Immunsystem schwächen und somit das Risiko für eine gestörte Scheidenflora erhöhen.
Ungeeignete Intimprodukte: Die Verwendung von Produkten mit hohem pH-Wert oder reizenden Inhaltsstoffen kann das vaginale Milieu negativ beeinflussen.
Symptome einer gestörten Scheidenflora
Anzeichen für ein Ungleichgewicht der Vaginalflora können sein:
Ungewöhnlicher Ausfluss: Veränderungen in Farbe, Geruch oder Konsistenz des vaginalen Ausflusses.
Juckreiz und Brennen: Reizungen im Intimbereich, die unangenehm sein können.
Unangenehmer Geruch: Ein fischiger Geruch kann auf eine bakterielle Vaginose hindeuten.
Trockenheit: Ein trockenes Gefühl in der Vagina, insbesondere während des Geschlechtsverkehrs.
Ein Ungleichgewicht der Vaginalflora kann das Risiko für eine Scheideninfektion erhöhen.
Bakterielle Vaginose und andere Infektionen
Eine häufige Folge einer gestörten Scheidenflora ist die bakterielle Vaginose. Dabei kommt es zu einer Überwucherung der Vagina mit anaeroben Bakterien wie Gardnerella vaginalis, während die Anzahl der schützenden Milchsäurebakterien abnimmt. Dies führt zu einem Anstieg des pH-Werts und begünstigt das Wachstum pathogener Keime.
Um Scheideninfektionen vorzubeugen, ist es wichtig, die Scheidenflora im Gleichgewicht zu halten.
Gesunde Vaginalflora
Eine gesunde Vaginalflora ist von entscheidender Bedeutung für die Gesundheit der Frau. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Infektionen und der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Intimbereich. Die Vaginalflora besteht hauptsächlich aus Milchsäurebakterien, die durch die Produktion von Milchsäure ein saures Milieu schaffen. Dieses saure Milieu mit einem pH-Wert zwischen 3,8 und 4,4 ist essenziell, um schädliche Keime in Schach zu halten und Infektionen vorzubeugen.
Aufbau und Erhalt einer gesunden Scheidenflora
Probiotika und Milchsäurebakterien
Die gezielte Zufuhr von Probiotika, die spezifische Milchsäurebakterien enthalten, kann helfen, die Vaginalflora zu stabilisieren. Studien haben gezeigt, dass die vaginale Anwendung von Präparaten mit Lactobacillus gasseri und Lactobacillus rhamnosus die schützende Scheidenflora wiederherstellen kann.
Ernährung und Lebensstil
Eine ausgewogene Ernährung, reich an Präbiotika wie Ballaststoffen, fördert das Wachstum nützlicher Bakterien. Der Verzehr von fermentierten Lebensmitteln wie Joghurt kann ebenfalls unterstützend wirken. Zudem ist es ratsam, Stress zu reduzieren und auf ausreichend Schlaf zu achten, um das Immunsystem zu stärken.
Eine ausgewogene Ernährung unterstützt die Gesundheit des gesamten Körpers, einschließlich der Scheidenflora.
Intimhygiene
Sanfte Reinigung: Hier sind einige Tipps zur richtigen Intimhygiene, um die Scheidenflora zu unterstützen. Verwenden Sie lauwarmes Wasser oder spezielle Intimwaschlotionen mit niedrigem pH-Wert.
Vermeidung von Vaginalduschen: Diese können die natürliche Flora aus dem Gleichgewicht bringen und sollten vermieden werden.
Atmungsaktive Kleidung: Baumwollunterwäsche und lockere Kleidung fördern ein gesundes Klima im Intimbereich.
Vermeidung von Risikofaktoren
Geschützter Geschlechtsverkehr: Die Verwendung von Kondomen kann dazu beitragen, das Eindringen basischer Substanzen wie Sperma zu verhindern, die den vaginalen pH-Wert erhöhen können. Die Vermeidung von Risikofaktoren kann helfen, Scheideninfektionen vorzubeugen.
Stress und Ernährung: Chronischer Stress sowie eine unausgewogene Ernährung können die Immunabwehr schwächen und somit auch die Vaginalflora negativ beeinflussen. Zuckerreiche Lebensmittel fördern beispielsweise das Wachstum von Hefepilzen wie Candida albicans.
Sexualverhalten: Ungeschützter Geschlechtsverkehr, häufiger Partnerwechsel oder die Verwendung ungeeigneter Gleitmittel können die Vaginalflora stören. Sperma hat einen alkalischen pH-Wert und kann das saure Milieu neutralisieren.
Bakterielle Vaginose – wenn Keime überhandnehmen
Eine der häufigsten Folgen einer gestörten Scheidenflora ist die bakterielle Vaginose (BV). Dabei kommt es zu einer Vermehrung schädlicher Bakterien, insbesondere Gardnerella vaginalis, während nützliche Laktobazillen verdrängt werden.
Typische Anzeichen:
Dünnflüssiger, grau-weißer Ausfluss
Fischartiger Geruch, insbesondere nach dem Geschlechtsverkehr
pH-Wert über 4,5
Unbehandelt kann BV das Risiko für aufsteigende Infektionen, Frühgeburten (bei Schwangeren) und sexuell übertragbare Erkrankungen erhöhen.
Tipps zum Aufbau und Erhalt einer gesunden Scheidenflora
1. Probiotika & Milchsäurebakterien
Die gezielte Einnahme oder vaginale Anwendung von Probiotika mit Milchsäurebakterien (z. B. Lactobacillus crispatus, L. rhamnosus, L. reuteri) kann helfen, die Vaginalflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Studien zeigen, dass bestimmte Präparate die Besiedlung mit schützenden Keimen fördern und das Rückfallrisiko bei BV oder Pilzinfektionen senken können.
➡ Empfehlenswerte Präparate sollten speziell für den vaginalen Bereich entwickelt und in Studien getestet sein – zum Beispiel Produkte wie Multi-Gyn FloraPlus oder Menoelle® Vaginalflora.
2. Milchsäurepräparate
Vaginale Gels oder Zäpfchen mit Milchsäure helfen, den pH-Wert zu stabilisieren und so das Wachstum unerwünschter Keime zu verhindern – insbesondere nach der Periode oder Antibiotikatherapie.
3. Sanfte Intimhygiene
Kein Einsatz von Seifen oder Intimwaschlotionen mit Duftstoffen
Tägliches Reinigen mit lauwarmem Wasser reicht völlig aus
Atmungsaktive Baumwollunterwäsche bevorzugen
Auf enge, synthetische Kleidung verzichten
4. Stärkung des Immunsystems
Eine gesunde Ernährung mit viel Gemüse, Ballaststoffen, fermentierten Lebensmitteln (z. B. Joghurt, Sauerkraut) und wenig Zucker unterstützt das Mikrobiom des Körpers – auch in der Vagina.
Einfluss von Hormonen – besonders in den Wechseljahren
In den Wechseljahren sinkt der Östrogenspiegel, wodurch die Schleimhäute dünner, trockener und anfälliger für Verletzungen und Infektionen werden. Gleichzeitig nimmt die Milchsäureproduktion ab, der pH-Wert steigt – das ideale Umfeld für Krankheitserreger.
➡ Eine vaginale Östrogentherapie (z. B. in Form von Cremes oder Zäpfchen) kann den Rückgang der Laktobazillen bremsen und die Scheidengesundheit verbessern.
Wann zum Arzt oder zur Ärztin?
Du solltest eine gynäkologische Praxis aufsuchen, wenn:
Symptome wie Juckreiz, Brennen, Ausfluss oder unangenehmer Geruch auftreten
Infektionen immer wiederkehren
Du eine Antibiotikatherapie abgeschlossen hast und vorbeugen möchtest
Du in den Wechseljahren unter Trockenheit oder häufigen Entzündungen leidest
Eine mikrobiologische Untersuchung des Vaginalsekrets kann klären, ob die Flora gestört ist, welche Keime vorherrschen und ob eine gezielte Therapie notwendig ist.
Fazit: Die Scheidenflora als Wächter der Intimgesundheit
Die Scheidenflora ist ein komplexes, sensibles System mit einer bedeutenden Schutzfunktion für die Frauengesundheit. Ein intaktes Mikrobiom sorgt für ein saures Milieu, wehrt Krankheitserreger ab und trägt entscheidend zum Wohlbefinden bei.
🔑 Der Schlüssel zu einer gesunden Scheidenflora liegt in einer Kombination aus bewusstem Umgang mit Intimhygiene, einer stabilen hormonellen Balance, der gezielten Anwendung von Milchsäurebakterien und einem gesunden Lebensstil.
Wissenschaftliche Quellen (Auszug):
Brotman, R. M. (2011). Vaginal microbiome and sexually transmitted infections: an epidemiologic perspective. The Journal of Clinical Investigation, 121(12), 4610–4617.
O’Hanlon, D. E., Moench, T. R., & Cone, R. A. (2013). Vaginal pH and microbicidal lactic acid when lactobacilli dominate the microbiota. PloS One, 8(11), e80074.
Martín, R., et al. (2008). Human vaginal microbiota and bacterial vaginosis: the role of probiotics. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 26, 59–65.
Borges, S., et al. (2014). Probiotic potential of Lactobacillus spp. isolated from the vaginal tract of healthy women. Journal of Applied Microbiology, 116(4), 1029–1037.